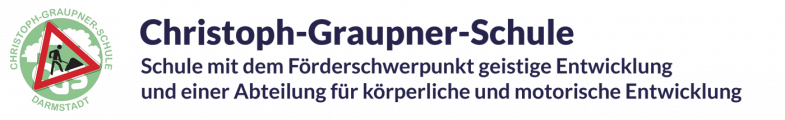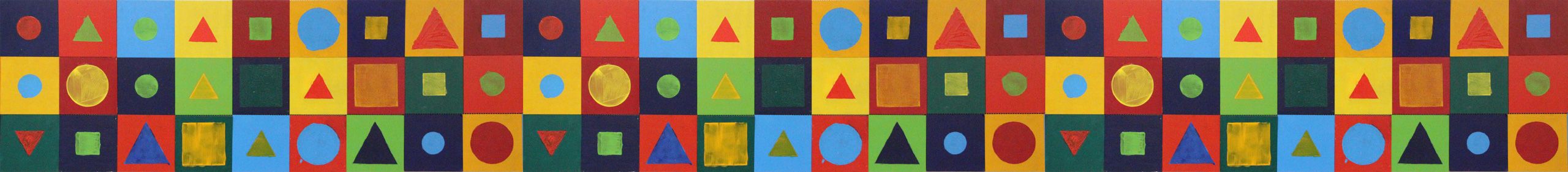Leitbild
Wir sehen jede Schülerin und jeden Schüler als
einmalige und wertzuschätzende Persönlichkeit.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist ihre individuelle Förderung
mit dem Ziel, sie zu befähigen, selbstbewusst und weitestgehend eigenverantwortlich
am Leben in Familie, Gesellschaft und Beruf partizipieren zu können.
Das Bildungsrecht von Menschen mit Behinderung ist durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949), die Kinderrechtskonvention (1989) sowie UN-Behindertenrechtskonvention (2006) garantiert.
Auf dieser Basis stehen wir als Schule dafür, dass
- die Beschulung eines Menschen keine bestimmten Fähigkeiten voraussetzt,
- jeder Mensch ein Recht auf Teilhabe und Teilnahme am Leben in der Gesellschaft hat.
- jeder Mensch zu seiner Entwicklung pädagogischer Angebote bedarf. Ein angenommenes potentielles zukünftiges Entwicklungsniveau darf Qualität und Quantität der Angebote nicht beeinflussen.
- jeder Mensch abhängig ist von anderen Menschen und des sozialen Austauschs bedarf.
- jede Handlung eines Menschen subjektiv sinnhaft ist und daher des Respekts und einer adäquaten Antwort bedarf.
Schulprogramm
Die Christoph-Graupner-Schule hat die Grundsätze ihrer Arbeit in ihrem Schulprogramm festgehalten. Welche Leitsätze sich daraus ergeben und wie wir dies in unserem schulischen Alltag umsetzen, wird im Prozess der Weiterentwicklung von Schule immer wieder überarbeitet und ist eine verbindliche gemeinsame Basis.
Neun Leitsätze beschreiben die pädagogische Arbeit und die Ziele der Schule. Sie bilden das Fundament der Zusammenarbeit aller am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten.
Leitsatz 1
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bilden die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.
Leitsatz 2
Wir gestalten einen offenen Unterricht in heterogenen Lerngruppen.
Leitsatz 3
Wir verknüpfen Lernsituationen innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes.
Leitsatz 4
Wir arbeiten im Team.
Leitsatz 5
Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist für uns ein wesentlicher Bestandteil der Förderung und Grundlage für einen gelingenden Erziehungsprozess.
Leitsatz 6
Wir tragen Mitverantwortung.
Leitsatz 7
Wir verstehen uns als Ausbildungsstätte und legen Wert auf Fort- und Weiterbildung.
Leitsatz 8
Wir unterstützen die Teilhabe unserer Schülerinnen und Schüler an ihrem gesellschaftlichen Umfeld.
Leitsatz 9
Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern demokratisches Handeln einzuüben und zu leben.
Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem und gefährlichem Verhalten
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die herausforderndes, selbstgefährdendes und/oder fremdaggressives Verhalten zeigen, steigt in allen Schulformen und Bildungsgängen an. In der Kombination mit einer geistigen Behinderung hat dieses Verhalten oft Auswirkungen, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche im schulischen Umfeld Verhaltensweisen zeigen, die für sie selbst zwar durchaus sinnhaft sind, aber das System an die Grenzen seiner Belastbarkeit oder darüber hinaus bringen. Strategien und Konzepte, die sich in der Arbeit in schwierigen Situationen in der Vergangenheit bewährt haben, greifen hier nicht mehr.
In der Christoph-Graupner-Schule ist daher die Entscheidung gefallen, das gesamte pädagogische Personal nach PART® zu qualifizieren. Wesentlich ist für uns als Schule, dass die Grundannahmen des von uns gewählten Ansatzes mit der in unserem Schulprogramm festgeschriebenen Grundhaltung vereinbar sind. Wesentlicher Bestandteil der Qualifizierung ist nicht nur das Einüben von Techniken, sondern vor allem die Entwicklung von Prinzipien und Haltung gegenüber dem Menschen in der Krise. PART® bietet allerdings – im Unterschied zu manchen Ansätzen - auch dann noch Handlungsoptionen, wenn die Situation trotzdem eskaliert.
Unter der Fragestellung „Wie können wir uns professionell auf extrem schwierige Situationen vorbereiten?“ sind die Ziele der PART-Schulung:
- Vorbeugung von Eskalationen durch Sicherheit vermittelndes Auftreten und vorausschauendes Handeln,
- Deeskalation durch frühzeitige kompetente Krisenkommunikation,
- Vermeidung von Verletzungen durch den Einsatz effektiver, aber schonender Körpertechniken
In den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 haben wir eine einführende Schulung des gesamten Kollegiums und die Ausbildung mehrerer Lehrkräfte als Inhouse-Trainer ermöglicht.
Ein Ergebnis von Pädagogischen Tagen und Konferenzen ist der Leitfaden, der die für ein professionelles Handeln notwendigen Aspekte aufzeigt und festschreibt:
- eine gemeinsame und verbindliche Handlungsgrundlage
- den pädagogischen Auftrag der Schule und damit auch dessen Grenzen
- ein flexibles Methodenrepertoire, das ein adäquates Handeln in unterschiedlichen Situationen ermöglicht
- den (schul-)rechtlichen Rahmen und die Abgrenzung von herausforderndem zu gefährlichem Verhalten
- Materialien zur Analyse und Dokumentation von herausforderndem gefährlichem Verhalten
- ein System der internen und externen Fallberatung
Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung
Auch Schülerinnen und Schüler mit komplexen (schweren und mehrfachen) Behinderungen gehören bei uns selbstverständlich dazu. Sie sind entsprechend ihrem Alter Teil einer Klasse. Diese Schülerinnen und Schüler bedürfen einer umfangreichen Unterstützung bei der hygenischen Versorgung und der Nahrungsaufnahme, weisen eine zusätzliche körperliche und/oder Sinnesbehinderung (z.B. Blindheit) auf und/oder können sich ausschließlich mit ihrer Körpersprache oder Methoden der Unterstützten Kommunikation verständigen.
Ihre Entwicklungsfortschritte bedürfen einer langanhaltenden und kontinuierlichen Förderung und sind in der Regel äußerst kleinschrittig. Dem Bereich der Wahrnehmungsförderung und basalen Angeboten kommt bei diesen Kindern und Jugendlichen eine zentrale Bedeutung zu.
Wir versuchen ihnen gerecht zu werden, indem wir ihre individuellen Lernvoraussetzungen und Aneignungsaktivitäten genau beobachten und ihnen davon ausgehend möglichst vielfältige Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen sowie unsere Schule mit geeigneten Räumen und Materialien ausstatten.
Unter den Stichworten basale Förderung, Unterstützte Kommunikation, Bewegung, Krankenpflege finden Sie weitere Informationen.
Arbeit im Team
In einem Klassenteam arbeiten grundsätzlich mehrere Personen unterschiedlicher Professionen miteinander Es ist die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihren/ihrer Qualifikationen den Lern,- Erziehungs- und Entwicklungsprozess der Schülerinnen und Schüler mit zu gestalten. Dies ermöglicht eine individuelle und gezielte Förderung der Schülerschaft innerhalb der Klassen/Stufen.
Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, Beziehungen zu unterschiedlichen Personen aufbauen zu können.
Die Teams werden von der Schulleitung unter Berücksichtigung der Kollegiumswünsche und unter Mitwirkung des Personalrates sowie der personellen und strukturellen Gegebenheiten der Schule zusammengesetzt. Vorrangig berücksichtigt werden die Bedürfnisse (z.B. individueller Pflegebedarf, medizinische Versorgung, besonderer Aufsichtsbedarf etc.) der Schülerinnen und Schüler. Ein Team besteht möglichst bis zum Schuljahreswechsel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, falls möglich, in höchstens zwei Teams eingesetzt.
Regelmäßige Teamsitzungen sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Hier werden verbindliche Absprachen zur Arbeit in den Lerngruppen getroffen, die dann gemeinsam getragen, umgesetzt und evaluiert werden.
Inklusion
Nach der Ratifizierung der UN Behindertenkonvention in Deutschland im Jahr 2008 befindet sich das Schulsystem auf einem neuen Weg. Laut dem hessischen Schulgesetz stellt die inklusive Beschulung von Kindern mit geistiger Behinderung den Regelfall dar. Alternativ können Eltern die Förderschule als Förderort wählen.
Inklusion als Partizipation am Leben in Schule und Gesellschaft soll uneingeschränkt für alle gelten. Die Diskussion, ob die dafür notwendigen Rahmenbedingungen inzwischen geschaffen wurden, wird an vielen Stellen geführt. Die Christoph-Graupner-Schule versteht sich daher als ein Angebot der Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Wir sehen unsere Aufgabe auch darin, die Idee der Inklusion voran zu treiben und Unsicherheiten, Befürchtungen und Berührungsängste abzubauen. Projekte mit verschiedenen anderen Schulen und die Mitwirkung an gemeinsamen Aktionen sind Bausteine in diesem Prozess. Insbesondere die Kooperationsklassen an der Luise-Büchner-Schule sind ein wichtiger Bestandteil dessen.